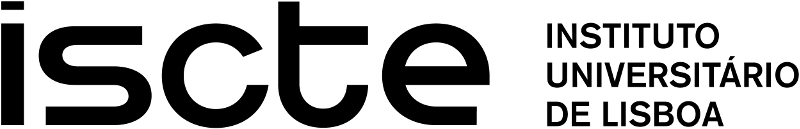Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10071/26476Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Wenzel, M. | - |
| dc.contributor.author | Waldzus, S. | - |
| dc.contributor.editor | Lars-Eric Petersen | - |
| dc.contributor.editor | Bernd Six | - |
| dc.date.accessioned | 2022-11-25T10:58:20Z | - |
| dc.date.available | 2022-11-25T10:58:20Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.identifier.citation | Wenzel, M., & Waldzus, S. (2020). Die Theorie der Selbstkategorisierung. EM Lars-Eric Petersen, Bernd Six (Eds.). Stereotype, Vorurteile und soziale Diskriminierung: Theorien, Befunde und Interventionen. Beltz. http://hdl.handle.net/10071/26476 | - |
| dc.identifier.isbn | 978-3-621-28789-0 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10071/26476 | - |
| dc.description.abstract | Die Theorie der Selbstkategorisierung (SCT; Turner, Hogg, Oakes, & Wetherell,1987) ist eine generellere Theorie der Gruppenformierung und sozialen Selbstdefinition, mit Implikationen nicht nur für Verhalten zwischen, sondern auch innerhalb von Gruppen. Sie erklärt sowohl Prozesse der Stereotypisierung und sozialen Diskriminierung als auch der Bildung von Gruppennormen, der sozialen Kohäsion und Kooperation, Führerschaft und generell des sozialen Einflusses (Haslam, 2004). Während die Theorie sozialer Identität (Tajfel & Turner, 1986 → Die Theorie der sozialen Identität) annimmt, dass Personen aus dem Bewusstsein ihrer Gruppenmitgliedschaft eine soziale Identität gewinnen, welches ihre Wahrnehmung, Motivationen und Verhalten gegenüber Mitgliedern anderer Gruppen als Individuum qualitativ verändert, ist theoretisch unterbestimmt, wann und wie genau sich Personen als Mitglieder einer Gruppe betrachten. Die SCT ist eine theoretische Weiterführung, die sich dieser Frage stellt und die beteiligten kognitiven Prozesse präzisiert. Die Theorie sozialer Identität und die SCT sind somit komplementär und bilden zusammen den sogenannten social identity approach (Haslam, 2004), welcher sich abgrenzt vom in der Gruppenforschung weit verbreiteten methodologischen Individualismus und sich einem metatheoretischen Interaktionismus verschreibt. Diese Ausrichtung ist zu betonen, da andererseits die Gefahr besteht, dass die Theorien trivialisiert und auf internale kognitive und motivationale Prozesse reduziert werden. Ihr wesentliches Anliegen ist, die Wechselwirkung zwischen sozialer Realität und Person zu begreifen: wie die soziale Umwelt und der Kontext die soziale Selbstdefinition des Individuums beeinflussen und umgekehrt diese wiederum die Wahrnehmung und Gestaltung der sozialen Welt. | ger |
| dc.language.iso | ger | - |
| dc.publisher | Beltz | - |
| dc.relation.ispartof | Stereotype, Vorurteile und soziale Diskriminierung: Theorien, Befunde und Interventionen | - |
| dc.rights | openAccess | - |
| dc.title | Die Theorie der Selbstkategorisierung | ger |
| dc.type | bookPart | - |
| dc.event.location | Weinheim | ger |
| dc.pagination | 258 - 267 | - |
| dc.peerreviewed | yes | - |
| dc.date.updated | 2022-11-25T10:57:36Z | - |
| dc.description.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | - |
| iscte.subject.ods | Educação de qualidade | por |
| iscte.subject.ods | Reduzir as desigualdades | por |
| iscte.subject.ods | Paz, justiça e instituições eficazes | por |
| iscte.identifier.ciencia | https://ciencia.iscte-iul.pt/id/ci-pub-71172 | - |
| Aparece nas coleções: | CIS-CLI - Capítulos de livros internacionais | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| bookPart_71172.pdf | 170,98 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.